Diesterwegstraße
Barmbek-Nord (1911): Friedrich Adolf Diesterweg (29.10.1790 Siegen – 7.7.1866 Berlin), Pädagoge
Siehe auch: Pestalozzistraße
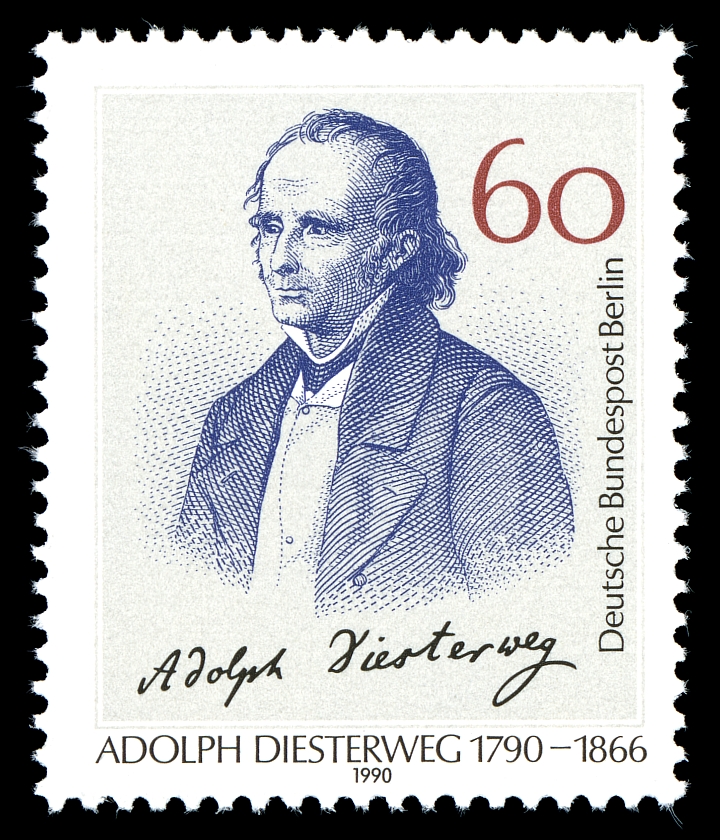
Die Straße wurde deshalb nach Diesterweg benannt, weil hier das Pestalozzistift stand und Diesterweg die Ideen Pestalozzis verbreitete.
Friedrich Adolf Diesterweg war der Sohn von Catharina Charlotte Diesterweg, geborene Dresler, Tochter des Stadtsekretärs und Schultheiß von Siegen und des Justizamtmannes Karl Friedrich Diesterweg.
„Nach Studium der Naturwissenschaft, Mathematik, Philosophie, Geschichte unterrichtete D. ab 1811 in Mannheim und Worms, ab 1813 an der Musterschule in Frankfurt, wo er durch G. A. Gruner und J. de Laspée die Lehren Pestalozzis kennenlernte.“ 1)
In dieser Zeit heiratete der damals 24-Jährige die damals 20-jährige Lehrerstochter Sabine Enslin (2.2.1793 Wetzlar – 27.6.1866 Berlin). Das Paar bekam 10 Kinder, das letzte, als Sabine Diesterweg 41 Jahre alt war. Hinzu kamen noch mehrere Fehlgeburten. Zwei Kinder starben im Kindes/Säuglingsalter. Trotz dieser vielen Kinder konnte Friedrich Adolf Diesterweg seine berufliche Karriere verfolgen. Seine Ehefrau übernahm die häuslichen und mütterlichen Geschäfte. Sie fühlte sich auch für das emotionale Wohlergehen in der Familie verantwortlich. Und so schreibt Klaus Goebel, der von Sabine Diesterweg verfasste Briefe herausgegeben hat: „Vor allem aber fühlt sich Sabine für das Wohlergehen der Kinder zuständig. Es spricht für die praktische pädagogische Einsicht eines vornehmlich mit Lehrerbildung und Theorie des Erziehungswesens beschäftigten Seminardirektors und Buchautors, die häusliche Aufgabenteilung hinzunehmen und die Rolle seiner Frau zu respektieren. Diese wiederum akzeptiert ihn ohne Widerspruch als Familienoberhaupt. Fünfzig Jahre zuvor hatte Friedrich Schillers ‚Lied von der Glocke‘ die Rollenverteilung im Bürgerhaus poetisch nachgezeichnet.
Die Beschreibung trifft für den Haushalt von Adolph und Sabine Diesterweg noch weitgehend zu. Sabine scheut sich nicht, zum Ausdruck zu bringen, was ihr als Mutter wichtig ist und worin ihr Mann sie nicht zu ersetzen vermag. Es lässt sich in den Briefen zwischen den Zeilen nachlesen. So liegt ihr die musikalische Erziehung der Kinder und die Pflege der Hausmusik am Herzen. Unschwer ist darin ein Erbe der eigenen Erziehung zu erkennen. Sie selbst soll in jungen Jahren wunderschön gesungen haben und singt noch gelegentlich bei Zusammenkünften im Familien- und Freundeskreis. Die Kinder spielen Instrumente und erfahren so wie ihr leicht erregbarer Vater auch im eigenen Heim sozusagen Musiktherapie. Sabine setzt einfühlsam und auf ihre Weise Aspekte der »naturgemäßen Erziehung« um, die Adolph in seinen Schriften fordert. Es lässt sich denken, dass sie für einige seiner theoretischen Vorstellungen das Vorbild abgegeben hat.“ 2)
Sabine Diesterweg folgte mit den Kindern ihrem Gatten, wenn dieser aus beruflichen Gründen in einer anderen Stadt Arbeit fand und bangte um den wirtschaftlichen Fortbestand der Familie, als Diesterweg 1850 seines Amtes enthoben wurde.
In der Neuen Deutschen Biographie heißt es über Diesterwegs beruflichen und politischen Werdegang: „er (…) gründete im Auftrag des preußischen Staates 1820 das Lehrerseminar in Moers und wurde dessen Direktor, 1832 Seminardirektor in Berlin. (…). Seit 1827 gab er die ‚Rheinische Blätter für Erziehung und Unterricht‘ heraus, seit 1851 daneben das ‚Pädagogische Jahrbuch für Lehrer und Schulfreunde‘. Auch seine Lehr- und Schulbücher, besonders Leitfäden für Geometrie, Arithmetik, die deutsche Sprache und den Elementarunterricht, wurden viel und lange benutzt, (…). Sie alle, wie auch sein Hauptwerk ‚Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer‘ (1836), zeigen den volkstümlichen Zug seines Denkens und die Richtung aufs Praktische. (…).“ 3)
Und weiter heißt es in der Neuen Deutschen Biographie über Pestalozzis Grundhaltung zum Leben: „In einer Grundhaltung, die weltanschaulich entscheidend von der Aufklärung und pädagogisch speziell von Rousseau, den Philanthropen und Pestalozzi bestimmt ist, kämpft er für eine bessere und einheitliche Grundlage der Volksbildung und für eine gewisse Eigenständigkeit von Erziehung und Schule gegenüber den verschiedenen gesellschaftlichen Mächten - nicht nur der Kirche, sondern auch dem Staat. Kritische Analyse der Zeitlage (‚Die Lebensfragen der Zivilisation‘, 1836) führte ihn zu entschiedenen sozialpolitischen und pädagogischen Forderungen: Eingreifen des Staates gegen drückendste Armut und Arbeitslosigkeit, genossenschaftliche Hilfe bei Krankheit und Unfall, bessere Schulbildung mit dem Ziel geistiger Mündigkeit für alle, dabei auch Fortführung des Unterrichts neben der Berufsausbildung über das 14. Lebensjahr hinaus, nicht zuletzt Weckung staatsbürgerlicher Verantwortung und verfassungsmäßig garantierte Mitarbeit der Bürger im Staat. Aus D.s Gesamthaltung entspringt sein Kampf gegen die politische, theologische und pädagogische Reaktion, gegen Obrigkeitsstaat wie kirchliche Orthodoxie und geistliche Schulaufsicht, aber auch gegen Konfessionsschule und sogar gegen alle bekenntnismäßig gebundene religiöse Erziehung, ebenso sein Bemühen um Hebung von Lehrerbildung und Lehrerstand und sein Eintreten für eine ‚naturgemäße‘, entwickelnde, auf Anschauung und Nähe gegründete Methode mit Abwehr von mechanischem Drill und Stoffhäufung.“ 4)
Diesterwegs liberale und progressive Einstellung musste damals unweigerlich zum Konflikt mit der Obrigkeit führen. Dazu schreibt Horst Rupp: „Die ab 1840 mit der Übernahme der preußischen Regentschaft durch Friedrich Wilhelm IV. (Regierungszeit als König bis 1858, gestorben 1861) verstärkt einsetzende staatliche Restauration und schließlich Reaktion und ihr Zusammenspiel mit der protestantischen Neoorthodoxie ließen seine pädagogischen und politischen Vorstellungen mehr und mehr ins gesellschaftliche Abseits geraten. 1847 wurde er schließlich in den vorläufigen, 1850 in den endgültigen Ruhestand versetzt, nachdem es im Zuge der 1848er Revolution für kurze Zeit so ausgesehen hatte, als ob eine für Diesterweg und seine Ideen günstige Wendung zu liberalen, demokratischen und konstitutionell abgesicherten Staatsverhältnissen möglich wäre.
In den 1850er und 60er Jahren musste Diesterweg den für ihn bitteren Siegeszug konservativ-reaktionärer Politik in Staat und Schule erleben. Im Bereich der Schule verkörperten für ihn die drei ‚preußischen Regulative‘, nach ihrem Autor, dem preußischen Staatsrat Ferdinand Stiehl (1812-1878) auch die ‚Stiehlschen Regulative‘ (1854) genannt, den Geist beziehungsweise auch Ungeist der Zeit. Dem Kampf gegen diese Regulative und das sie prägende Weltbild galt seine ganze Kraft bis zu seinem Lebensende. Seit 1858 wirkte er als Abgeordneter im preußischen Landtag in diesem Sinne. Eine durchgreifende Änderung der Verhältnisse zu erleben war ihm aber bis zu seinem Tod am 7.7.1866 in Berlin nicht vergönnt.“ 5)
Diesterweg starb an der Cholera, seine Frau war kurz zuvor ebenfalls an dieser Krankheit verstorben.