Rudorffweg
Bergedorf/Lohbrügge (1949): Ernst Rudorff (18.1.1840 Berlin -31.12.1916 Lichterfeld/Berlin), Begründer der deutschen Naturschutzbewegung.
Siehe auch: Schumannstraße
Siehe auch: Hermann-Löns-Höhe
Vor 1949 hieß die Straße Schwarzer Kamp. Bereits in der NS-Zeit sollte die Straße im Zuge des Groß-Hamburg-Gesetzes in Rudorffweg umbenannt werden, da nun das bisherige Staatsgebiet Hamburg um benachbarte preußische Landkreise und kreisfreie Städte erweitert worden waren und es dadurch zu Doppelungen bei Straßennamen kam. Bedingt durch den Krieg kam es nicht mehr zu dieser Umbenennung und es blieb bis 1949 bei Schwarzerkamp und wurde dann umbenannt in Söderblomsrraße (vgl.: Staatsarchiv Hamburg 133-1 II, 26819/38 Geschäftsakten betr. Straßennamen B. Die große Umbenennung hamb. Straßen 1938-1946. Ergebnisse der Umbenennung in amtlichen Listen der alten und neuen Straßennamen vom Dez. 1938 und Dez. 1946)
Die Straße wurde nach Ernst Rudorff benannt, weil er als Begründer der deutschen Naturschutzbewegung gilt. Darüber hinaus war er auch noch Komponist und Musikpädagoge - dazu später.
Rudorff und die Naturschutzbewegung/Heimatschutz
In Wikipedia ist nachzulesen: „1897 prägte Rudorff das Wort ‚Heimatschutz‘ in einer ausführlichen Darstellung seiner Gedanken und Forderungen. Zusammen mit den beiden Artikeln im Grenzboten war dies der Anlass zur Gründung des Deutschen Bundes Heimatschutz am 30. März 1904. Hierbei war Rudorff dagegen, dass auch Deutsche jüdischen Glaubens und Frauen den Gründungsaufruf unterzeichneten. Auch in seinen Schriften bediente er sich völkischer Argumente. Mit seiner Vorstellung von Naturschutz als ‚Heimatschutz‘ wollte er den ihm verhassten ‚Materialismus‘ und die ‚Ideen der roten Internationale‘ bekämpfen.“ 1)

Über antisemitische Tendenzen in der Heimatschutzbewegung schreibt Toralf Staud auf den Online-Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung am 10.9. 2015 in seinem Beitrag „Grüne Braune. Wenn sich Rechtsextreme mit Öko-Themen befassen, ist die Überraschung meist groß. Dabei zeigt ein genauer Blick: ‚Heimatschutz‘ war von Anfang an ein Thema im rechten Lager. Deshalb ist es kein Wunder, dass sich auch die NPD seit Jahrzehnten um Umweltbelange und ‚Heimatschutz‘ kümmert.“2) Toralf Staud argumentiert: „(…) Die Wurzeln des Naturschutzes in Deutschland waren nämlich nicht links, liberal oder anarchistisch, sondern vor allem konservativ, nationalistisch und völkisch. Als Ende des 19. Jahrhunderts auch im Deutschen Reich Industrialisierung und Verstädterung voranschritten und sich damit die traditionellen Kulturlandschaften rasant veränderten, störte das vor allem Bildungsbürger: kulturpessimistische und modernisierungskritische Professoren, Gymnasiallehrer, Verwaltungsbeamte oder Künstler. Den wuchernden Städten, in denen angeblich Dekadenz und Sittenverfall herrschten, hielten sie ein romantisches Ideal vom deutschen Wald oder dem Bauern auf eigener Scholle entgegen.
Es entstand eine ‚Heimatschutzbewegung‘. Diese wollte die Natur weniger wegen ihres Eigenwertes bewahren, sondern vor allem wegen ihrer angeblichen Bedeutung für die deutsche Kultur.“ 3)
Dabei spielte auch Ernst Rudorff eine bedeutende Rolle. Dazu Toralf Staude: „Um ‚deutsches Volkstum ungeschwächt und unverdorben zu erhalten‘, schrieb beispielsweise der Berliner Musiker Ernst Rudorff, müsse man ‚die deutsche Heimat mit ihren Denkmälern und der Schönheit der Natur vor weiterer Verunglimpfung schützen‘. Rudorff und seinen Zeitgenossen ging es stark um Ästhetik, weshalb sie sich beispielsweise über die plötzlich überall in der Landschaft auftauchenden großen Reklameschilder (für aufkommende industrielle Massenprodukte, etwa Odol-Mundwasser oder Knorr-Suppenpulver) echauffierten. In dem 1904 von ihm gegründeten Bund Heimatschutz sah Rudorff übrigens für Juden oder Frauen keinen Platz.
Zwar sei das Denken dieser frühen Heimatschützer bereits kompatibel mit dem Rassismus der völkischen Bewegung gewesen, so der Jenaer Kulturwissenschaftler Friedemann Schmoll; doch eine engere Verknüpfung beider habe es erst nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg und der danach immer stärker um sich greifenden nationalen Aufbruchstimmung gegeben. Nun ging es beim Schutz der Heimat nicht mehr nur um die deutsche Kultur, sondern gleich um die deutsche, germanische, arische ‚Rasse‘. Die Bücher des völkischen Schriftstellers Hermann Löns [siehe: Hermann-Löns-Straße, benannt 1978 in Lurup und Hermann-Löns-Weg, benannt 1925 in Fuhlsbüttel, Hermann-Löns-Höhe, benannt 1927 in Bergedorf, R. B.] erreichten zwischen den beiden Weltkriegen Millionenauflagen. ‚Naturschutz ist Rasseschutz‘ hieß es bei ihm. Der ‚letzte und wichtigste Zweck des gesamten Heimatschutzes‘ sei der ‚Kampf für die Gesunderhaltung des gesamten Volkes, ein Kampf für die Kraft der Nation, für das Gedeihen der Rasse‘.
Nun verschmolzen auch Heimatschutz und Antisemitismus. Reklametafeln in der Landschaft galten nicht mehr nur als Zeichen eines kulturlosen, kapitalistischen Materialismus‘, sondern als hässlicher Ausdruck einer ‚jüdisch-liberalistischen Wirtschaftsauffassung‘, eines ‚undeutschen, das Händlerische allem anderen voranstellenden Geistes‘. Mehr noch: ‚Dem Juden‘ wurde grundsätzlich die Fähigkeit abgesprochen, überhaupt ein ‚inneres Verhältnis‘ zur Natur entwickeln zu können – weil er ein ‚ewiger Nomade‘ sei und daher ‚keine Heimat‘ habe. Demgegenüber sei eine ‚innige Naturverbundenheit‘ ein ‚Kennzeichen des germanischen Gemütslebens‘ und ein ‚Merkmal unserer Rasse‘, wie es etwa Walther Schoenichen formulierte, der langjährige Leiter der obersten Naturschutzstelle in Preußen.
Er und zahlreiche Andere schlossen sich in den 1930er Jahren den Nationalsozialisten an, weil sie unter einer NSDAP-Regierung die besten Chancen sahen, ihre Ziele zu verwirklichen.“ 4).
Ernst Rudorff und die Frauenfrage
In einer Zeit, in der die bürgerliche und proletarische Frauenbewegung für mehr Rechte für Frauen kämpfte, wollte Ernst Rudorff nicht, dass Frauen den Gründungsaufruf des Bundes für Heimatschutz unterschrieben. Auch war er, der 1869 eine Professur (bis 1910) an der neu errichteten Königlichen Hochschule für Musik in Berlin annahm und der erste Lehrer für Klavierspiel und Leiter der Klavierklassen wurde, dagegen, dass Frauen in die Berliner Hochschule für Musik „eindrangen“. So schrieb er im Dezember 1881 an Joseph Joachim einen Brief und beklagte sich über das „Eindringen“ der Frauen. Dieses „sei schon an der Tagesordnung“. Doch einige Bereiche, sollten seiner Meinung nach, vor dieser Entwicklung geschützt werden: „Die Musik haben sie schon fast in allen Teilen in Beschlag genommen; man sollte wenigstens Sorge tragen, daß nicht auch in Zukunft unsere Orchester gar aus Männern und Weibern zusammengesetzt werden“.
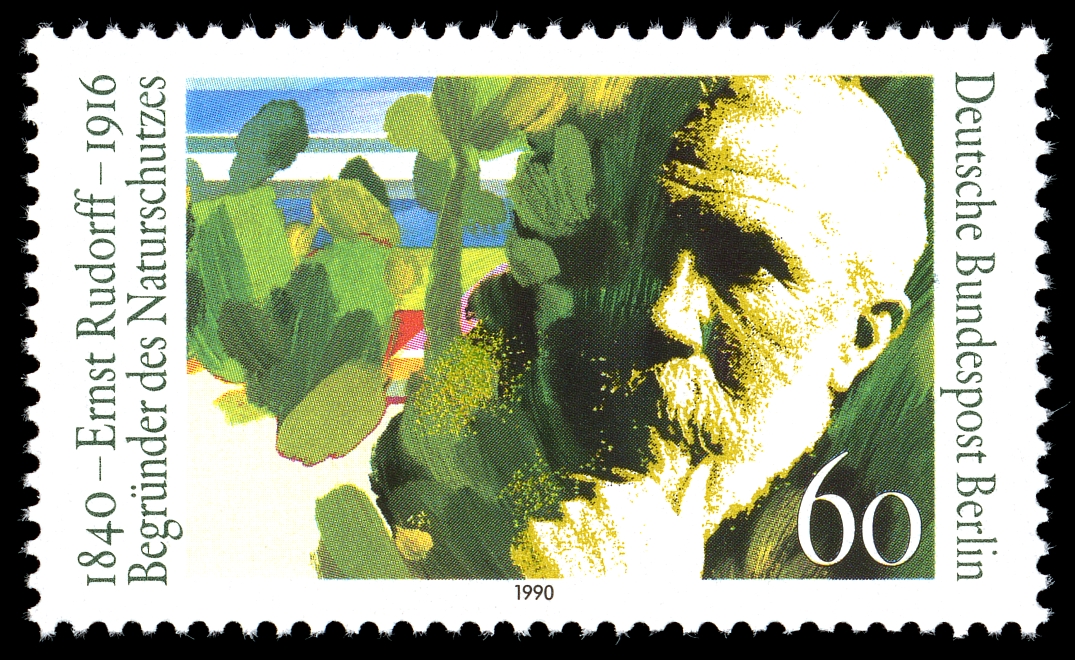
Wie er sich eine sinnvolle Betätigung für ledige Bürgerfrauen vorstellte, formulierte er in einem Aufsatz, den er 1879 im Heft 39 der „Gartenlaube“ veröffentlichte. Der Titel seines Artikels lautete „Ein Arbeitsfeld für edle Frauen“: „Unter den brennenden Fragen, welche die Jetztzeit bewegen, steht die Frauenfrage mit in erster Linie, und mancher dankenswerthe Schritt ist zu ihrer Lösung vorwärts gethan worden. Ich möchte im Folgenden ein Uebel beleuchten, das manches weibliche Wesen, welches nicht gegen die gemeine Noth des Lebens anzukämpfen hat, schwer beunruhigt: die Berufslosigkeit. Hat heute ein Mädchen die Mitte der zwanziger Jahre überschritten, hat der Reiz der Bälle und Gesellschaften, die Freude an allerlei dilettantenhaften Versuchen nachgelassen, so kommt der Moment, in welchem jedes edlere, geistig kräftige Frauengemüth zu der immer brennender sich gestaltenden Frage gelangt: Wohin? Wie verwende ich die in mir ruhenden Anlagen und Kräfte am ersprießlichsten für mich und Andere? In einer aus gegenseitiger Neigung geschlossenen Ehe ist der schönste und naturgemäßeste Wirkungskreis gegeben, in dem alle edlen Keime der Frauennatur sich entwickeln können. Allein – wir wissen es alle – unsere Zeit mit ihren gesteigerten Forderungen an materiellen Genuß macht Eheschließungen, falls nicht einer der Ehegatten über größere Mittel verfügt, immer schwieriger. Womit soll nun das unverheirathete Mädchen sich beschäftigen die langen Tage hindurch? In den höheren Ständen suchen einige ihre Kräfte zu verwerthen, indem sie Unterricht an Privatschulen unentgeltlich ertheilen, ohne hierbei zu bedenken, daß sie dadurch den auf Erwerb angewiesenen Mädchen eine traurige Concurrenz bereiten. Andere fertigen Arbeiten für Läden und Bazars an und drücken – da sie an einem sehr geringen Preise Genüge haben – den bereits allzu kärglichen Lohn der armen Arbeiterinnen noch mehr herunter. Eine wirkliche Befriedigung giebt es für thatkräftige, bedeutender angelegte Naturen bei solchem Thun nicht. Je reifer sie werden, desto mehr drängt es sie, ihre eigenen Bahnen zu verfolgen, ihre individuelle Ansichten und Grundsätze zu verwerthen. Die Stimme in ihrem Innern wird immer mächtiger: ‚Ich will durch mein Handeln erproben, ob ich durch meines Wesens Kraft mir Hochachtung und ehrende Liebe erringen kann, ich will nicht über die Erde gehen, ohne segensreiche Spuren meines Waltens zurückzulassen.‘ Solche Gedanken haben sicherlich auch die Seele der wackern Frau bewegt – Miß Octavia Hill – von deren Thun ich hier berichten möchte, um dabei die innige, dringende Bitte an deutsche Frauen auszusprechen: Folget ihr nach! Hier ist das schönste Arbeitsfeld gefunden, das ein edles, wirkensdurstiges Frauenherz nur ersehnen kann. Miß Octavia Hill hat eine Schilderung dessen, was sie unternommen, sowie der Resultate ihres Schaffens in Aufsätzen niedergelegt, welche in der ‚Fortnightly Review‘, in ‚Macmillan’s Magazine‘ und anderen Zeitschriften veröffentlicht worden sind. Die leider so früh dahingeschiedene Großherzogin Alice von Hessen ließ diese Berichte in’s Deutsche übersetzen und hat dem kleinen Werke eine Vorrede beigefügt, aus welcher ich das Bemerkenswertheste jetzt folgen lasse: ‚Dieses kleine Buch,‘ heißt es dort, ‚enthält die Geschichte des Wirkens einer edlen Frau, welche mir vergönnt war bei meinem letzten Besuch in meiner englischen Heimath kennen zu lernen und in ihrer Thätigkeit zu beobachten. Der tiefe Eindruck, den ich von ihrer selbstlosen, thatkräftigen und reichgesegneten Liebe mit hinwegnahm, erfüllte mich mit dem Wunsche, daß uns, die wir ähnliche Zwecke und, wie ich hoffe, in demselben Geist, verfolgen, das Anschauen eines so edlen Beispieles in unserer eigenen Arbeit ermuthigen und stärken möge. Systeme mögen, wie Miß Hill richtig bemerkt, werthvoll, ja nöthig sein, aber in den meisten Fällen und jedenfalls in diesem sind sie wie eine Maschine: nutzlos oder schlimmer als das, wenn das beseelende Element der Persönlichkeit in den Plan ihrer Wirkung nicht aufgenommen ist. Das Buch zeigt, wie Miß Hill mit ebenso viel richtigem Tact wie aufopfernder Liebe, durch Geduld und standhaftes Beharren bei den einmal gewonnenen Grundsätzen, Freundin ihrer Armen zu werden verstand, ohne deren Liebe durch Almosen zu erkaufen, und ihnen unendliches Gute that vor Allem durch Aufschließung und Entwickelung ihrer eigenen moralischen Hülfsquellen. Solches Streben wird immer von Schwierigkeiten und Enttäuschungen begleitet sein. Wir selber haben ja dazu beigetragen, die Armen zu demoralisiren, indem wir in den Tag hinein Unterstützungen austheilten, ihre Selbstachtung, ihren Willen und ihre Fähigkeit zur Selbsthülfe untergruben. Aber es ist Zeit, dem ein Ende zu machen und als den Hauptgesichtspunkt einer verständigen und wahrhaft liebevollen Armenpflege den erziehlichen zu erkennen.‘ – Soweit die Vorrede der Großherzogin Alice! Zur richtigen Würdigung des menschenfreundlichen Wirkens der Miß Hill möge das Folgende gesagt sein. In London sind, wie in den großen Städten unseres Vaterlandes, Wohnungen für die Arbeiterclasse knapp und verhältnißmäßig theuer. Miß Hill hatte sich längere Zeit mit der sehr richtigen Idee getragen, daß ein Hausbesitzer, welcher gesunde, saubere Quartiere an Arbeiter und andere sich um das tägliche Brod mühende Leute zu billigen Preisen vermiethet, einen große Einfluß auf diese gewinnen müsse. Sie beschloß, sich in Besitz solcher Häuser zu setzen und alle ihre Kraft aufzuwenden, um die Bewohner derselben zu Ordnung, Sauberkeit und Pünktlichkeit in Erfüllung ihrer Pflichten zu erziehen und dadurch auch deren geistige Erhebung zu bewerkstelligen. Wie Miß Hill dies erfüllt, will ich, zumeist mit ihren eigenen Worten, hier anführen; ich habe dazu aus mehr als hundert Seiten das Nothwendigste zusammengestellt. ‚Vor etwa vier Jahren,‘ sagt unsere englische Menschenfreundin, ‚gelangte ich in den Besitz dreier Häuser in einer der schlimmsten Gassen von Marylebone. Sechs weitere Häuser wurden nach und nach dazu gekauft. Alle waren mit Insassen überfüllt. Das Erste, was geschehen mußte, war, sie in die Verfassung zu setzen, in welcher sie mit Anstand vermietet werden konnten. Die Häuser waren in einem erbärmlichen Zustande. Der Bewurf fiel von den Wänden herunter; auf einer Treppe stand ein Eimer, um den Regen aufzufangen, der durch das Dach hereinfiel. Alle Treppen entbehrten der Geländer, die von den Miethsleuten als Brennholz verbraucht worden waren. Das Pflaster in den Hinterhöfen war aufgebrochen; große Pfützen hatten sich darin gebildet, aus denen die Feuchtigkeit an den Außenmauern hinaufstieg. Sobald ich das Besitzthum übernommen hatte, erhielt jede Familie Gelegenheit sich zu verbessern, indem denjenigen, welche nicht zahlen wollten oder ein offenkundig unmoralisches Leben führten, gekündigt wurde. Die Zimmer, die sie freiließen, wurden gereinigt; andere Miethsleute, die Zeichen von Besserung an den Tag legten, rückten in dieselben ein, und auf diese Weise ergab sich die Möglichkeit, ein Zimmer nach dem anderen ausbessern und anstreichen zu lassen. Alle altersschwarzen Schichten von Papier und Lappen wurden von den Fenstern gerissen und Glas eingesetzt – von 192 Scheiben waren nur 8 unzerbrochen; Hof und Fußsteig wurden gepflastert.‘ Es gilt bei Miß Hill als Regel, daß unter ungefährer Beibehaltung der alten Zimmerpreise den Miethern mit zahlreicher Familie zwei Zimmer abgelassen werden, für weit geringeren Preis, als für dieselben Zimmer in Einzelmiethe verlangt wird. Keinem Miether wird eine ungenügende Räumlichkeit überlassen, keine Aftermiethe wird gestattet. Die Reinhaltung von Treppen und Gängen wird älteren Mädchen gegen Bezahlung übertragen, wodurch sie sich an Reinlichkeit gewöhnen und die Insassen der Zimmer zu gleicher Sauberkeit anspornen. Miß Hill bemerkt mit Recht, daß einerseits die Erfüllung der wechselseitigen Pflichten zwischen der Hauswirthin und den Miethsleuten, andererseits aber auch die aus genauer Bekanntschaft und einem gewissen Gefühl von Abhängigkeit und Schutz entspringende persönliche Freundschaft zur Erreichung ihrer menschenfreundlichen Absichten Hand in Hand gehen mußten. Durch ein solches Verhältniß wurde Miß Hill befähigt, ‚die wirkliche Lage der Familien zu erkennen, ihnen bei Zeiten die unvermeidliche Folge dieser oder jener Gewohnheiten vorauszusagen, auf Maßregeln zu dringen, welche die Erziehung der Kinder und ihre Selbstständigkeit im Leben sichern, die Keime der Energie lebendig zu erhalten, weichere Regungen des Gemüthes zu wecken, jede Hülfe entschlossen zu versagen, die nicht Selbsthülfe hervorruft, den kleinsten Schimmer von Selbstachtung liebevoll zu pflegen und schließlich mit starker Hülfe nahe zu sein, wenn die Stunde der Prüfung schwer und unerwartet erscheinen sollte, und diese Hülfe zu leisten mit der Hand und dem Herzen eines wirklichen alten Freundes, der noch in ganz anderem Verhältnisse zu dem Bedrängten steht, als in dem des Almosengebens, und der dadurch das Recht gewonnen hat, diese niedrigere Art der Hülfe auch denen zu bieten, die am meisten auf Unabhängigkeit halten.‘ Die Miethsleute der Miß Hill gehörten zu den eigentlichen Armen. Aber außer solchen, die nicht den Willen zum Erwerb hatten, haben sie sich Alle im Laufe der vier Jahre, während welcher sie unter der Obhut der Miß standen, zu bedeutend besseren Verhältnissen emporgerungen. Was den ordentlichen Miethsleuten die meisten Schwierigkeiten beim Zahlen bereitete, das waren die Schwankungen im Verdienste. Miß Hill half ihnen auf zweierlei Art: Erstens hielt sie dieselben an, zurückzulegen – was sie mit Ausdauer thaten, sodaß jeder Herbst sie mit einem kleinen angesammelten Capitale ausgerüstet fand, von dem sie zehren konnten, so lange die Arbeit während der ‚todten Jahreszeit‘ nachließ. Zweitens that sie, was sie konnte, um ihren Miethsleuten während flauer Zeitläufte Beschäftigung zu schaffen. Sie sparte sorgfältig jede Arbeit, die sie thun konnten, für solche Zeiten auf. Erspartes Geld sammelte sie persönlich ein und verließ sich nicht darauf, daß es an entfernt liegende Banken und Sparvereine abgeliefert würde. ‚Schließlich wußte ich,‘ fährt Miß Hill fort, ‚daß ich lernen müßte, diese Leute als meine Freunde zu betrachten und dadurch instinctmäßig dieselbe Achtung vor ihrer häuslichen Unabhängigkeit zu hegen, sie mit derselben höflichen Rücksicht zu behandeln, wie ich beides irgend einem anderen Freunde beweise. Es durfte keine Einmischung vorkommen, kein Eindringen in ihre Zimmer ohne Aufforderung, kein Anerbieten von Geld oder Gegenständen des Lebensbedarfes. Wenn aber die Gelegenheit selbst kam, mußte ich ihnen jede Hülfe gewähren, wie ich sie anderen Freunden, ohne zu verletzen, auch darbieten kann – Theilnahme in ihrer Betrübniß, Rath und Beistand in ihren Schwierigkeiten, nützliche Empfehlungen, Mittel der Erziehung, ein Buch, um in den Tagen der Arbeitsunfähigkeit zu lesen. Ich bin überzeugt, daß Vieles von dem, was für die Armen gethan wird, unter anderen Uebeln an einem Mangel von Zartgefühl und höflicher Rücksicht krankt und daß wir ihnen nicht in wohlthätiger Weise helfen können, sobald es in irgend einem andern Geiste geschieht, als in dem wir unseres Gleichen helfen würden. Es ist ein großer Vortheil, der aus der Einrichtung dieser Häuser entspringt, daß sie eine Prüfungsschule bilden, in welcher die Leute sich besserer Situationen würdig beweisen können. Nicht wenige der Miethsleute sind unter die gesellschaftliche Schicht, in welcher man sie einst gekannt hatte, herabgesunken, und einige von diesen gewannen einfach dadurch, daß sich ihr Charakter bewährte, ihre frühere Lebensstellung wieder. Ein Mann war vor zwanzig Jahren Diener einer Herrschaft gewesen, hatte Geld gespart, ein Geschäft angefangen, geheirathet, fallirt und war dann damit aus den Fugen des Verdienstes gekommen. Als ich ihn kennen lernte, hatte er ein erbärmliches Stück Brod für seine Frau und sieben Kinder, und alle neun siechten und sanken dahin, ohne daß Jemand davon wußte. Nachdem ich ihn drei Jahre lang beobachtet und geprüft hatte, konnte ich ihn einem Herrn auf dem Lande empfehlen, wo nun die Familie statt eines Zimmers deren sechs bewohnt, frische Luft und regelmäßigen Lohn genießt. Es ist aber viel leichter, hülfreich zu sein, als Geduld und Selbstbeherrschung genug zu haben, um zeitweise Leiden zu sehen und ihnen nicht abzuhelfen. Und doch muß der Ton der Behandlung im Wesentlichen ein strenger sein. Es bedarf vieler Verweise und Zurückweisungen, wenn auch eine tiefe, stille Unterströmung von Mitgefühl und Erbarmen darunter hergehen mag. Ein schöner Zug in dem Charakter der Armen ist ihr Vertrauen; es war ganz wunderbar zu beobachten, wie groß und wie bereitwillig dieses ist. In keinem einzigen Fall ist mir Argwohn begegnet, oder irgend etwas anderes als vollkommenes Vertrauen. Es ist unnöthig zu sagen, daß es nicht an kleinen Schwierigkeiten und Enttäuschungen gefehlt hat. Jeder Einzelne, dem es nicht gelang sich soweit zu erheben, um die so gern gebotene Hülfe zu ergreifen, ist für mich ein fühlbarer Verlust gewesen; denn ein wirkliches Gefühl, daß diese Leute zu mir gehörten, ist in mir lebendig geworden, und ich habe ein starkes Bewußtsein von Verantwortlichkeit gehabt, auch wo am wenigsten Liebenswerthes in einem Charakter zu finden war.‘ Nach der finanziellen Seite hin erzielte Miß Hill einen befriedigenden Erfolg; denn es konnte bei einem Ertrag von fünf Procent Zinsen für das angelegte Capital nicht nur ein Fonds zur Rückzahlung angesammelt, sondern auch eine reichliche Bewilligung für Reparaturen gemacht werden, und hier muß der Mittel gedacht werden, wodurch die Miether gewöhnt wurden, sich mit Zerbrechen und Verwüsten in Acht zu nehmen. Die für Reparaturen jährlich bewilligte Summe ist für jedes Haus festgesetzt; bleibt etwas davon übrig, so wird der Rest zu solchen weiteren Bequemlichkeiten verwandt, welche die Miether selbst wünschen. Auf diese Weise liegt es in ihrem eigenen Interesse, die Ausgaben für Reparaturen so niedrig wie möglich zu halten, und anstatt leichtsinnig Schaden anzurichten, sind sie darauf bedacht, Beschädigungen zu vermeiden, und zeigen sich hülfreich und erfinderisch in sparsamer Herstellung des Zerbrochenen und Verdorbenen. Miß Hill ließ auch ein großes Versammlungszimmer für die Mietsleute bauen; das dazu verwendete Capital verzinste sich gleichfalls aus den Mietbeträgen. ‚Hier werden nun,‘ berichtet sie, ‚die Unterrichtsstunden gehalten – zweimal wöchentlich für Knaben, einmal für Mädchen. Eine zahlreich besuchte Arbeitsstunde für Frauen und erwachsene Mädchen findet einmal wöchentlich statt. Es ist eine gute Zeit zu ruhigem Gespräch mit ihnen, indeß wir da arbeiten, und manches nachbarliche Gefühl wird unter den Frauen erweckt, wenn sie zusammen auf einer Bank sitzen, einander Nadel oder Faden leihen, von derselben Hand bedient werden, von derselben Person Leitung erwarten. Auch einen Spielplatz – einen ummauerten Raum – habe ich für die Kinder einrichten lassen. Bisher haben Balltreiben, Schlagball, Schaukeln, Springen und das Singen einiger Kindergartenlieder mit übereinstimmenden Bewegungen die Hauptunterhaltung geliefert. Vor Kurzem aber habe ich für die Knaben das Exerciren eingeführt mit einer Trommel- und Pfeifenbande. Leider nahm die Sorge für die Häuser soviel Zeit in Anspruch, daß der Spielplatz etwas vernachlässigt wurde, und doch ist er ein höchst wichtiger Theil des Werkes. Die Uebel der Straßen und Gassen sind zu offenbar, um der Auseinandersetzung zu bedürfen. Der moralische Einfluß des Spielplatzes hängt indeß davon ab, daß sich Damen finden, die hinkommen, Spiele angeben, als Schiedsrichter auftreten, die Kinder kennen lernen und sich ihrer annehmen. Solcher hoffe ich immer zu finden.‘ Mit sehr viel Tact und Feingefühl hat Miß Hill es verstanden, durch Anrufung des Schönheitssinnes ihrer Schutzbefohlenen zu deren sittlicher Erziehung beizutragen Das Leben der Armen ist eintönig; sie suchen gemeine Vergnügungsorte auf; sie stürzen sich in den Strudel wilder Belustigungen. Nun lud aber Miß Hill sie zu edleren, von Schönheit verklärten Vergnügungen als ihre Gäste ein; ein angeborenes Ehrgefühl erhielt den guten Ton in der ganzen Gesellschaft. ‚Sicherlich,‘ ruft sie aus, ‚es kann keinen erhebenderen, dankbareren Augenblick geben, als wenn wir eine große Anzahl dieser Menschenkinder, denen das Leben dumpf und sorgenvoll verfließt, zu einem fröhlichen heiligen Christfest um uns versammelt sehen, oder wenn wir sie ist der schönen Sommerzeit nach einem heiteren, stillen Orte führen, wo sie, durch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit unter einander verbunden, durch die Gegenwart derer, die sie lieben und von ihnen geliebt werden, unbewußter Weise vor Unrecht bewahrt werden. Alle diese Gelegenheiten des Zusammenkommens sind für unser Verhältniß zu den Armen unschätzbar, und doch würden sie wenig nützen ohne die geschäftliche Beziehung, die uns mit ihnen verbindet, ohne die Fürsorge, die jedem einzelnen Mitgliede des kleinen Kreises zu Theil wird. Allwöchentlich beim Einziehen der Miethe findet sich die Gelegenheit, jede Familie allein zu sehen. Da giebt es eine Menge Dinge zu verhandeln. Erstens, die rein äußerlichen Geschäftssachen: Erhebung der Miethe, Wünsche der Miethsleute in Bezug auf Reparaturen; zuweilen Entscheidungen bezüglich des Verhältnisses zu anderen Miethern, dann wieder Verweise wegen vorgekommener Unordnungen. Eine wesentliche Rolle spielen die traurigen oder erfreulichen Mittheilungen über Gesundheit, Verdienst, über die kleinen Ereignisse der Woche. Zuweilen erheben sich schwere Fragen über wichtige Wendepunkte im Leben der Familie – soll die Tochter in Dienst gehen? soll man das kranke Kind in das Spital bringen? etc.‘ Im Laufe der Zeit trugen denn diese mancherlei Methode ihre Früchte in dem kleinen Reiche der Miß Hill. ‚Das Gefühl, einer ruhigen Ueberlegenheit und einem herzlichen Mitgefühl zu begegnen,‘ sagte sie, ‚machte sich geltend, und immer weniger kamen Ausbrüche von Wildheit und Rohheit uns gegenüber vor. Noch ehe der erste Winter vorüber war, geschah es öfter, daß Jemand sich beeilte, uns die Treppe hinauf zu leuchten, und anstatt daß mir, wie früher, das Miethbuch nebst Geld durch die halboffene Thür zugestoßen wurde und ein fest dawider gestemmter Fuß mir den Eingang verwehrte, war nun mein Empfang: ‚O Fräulein, können Sie nicht auf einen Augenblick hereinkommen und sich setzen?‘ Anfangs gehe ich zu regelmäßigen Zeiten in die Häuser, dann reinigen sie Alles zu meinem Empfang; sie haben das Vergnügen, für mich Vorbereitungen zu treffen und meine Befriedigung zu sehen; später komme ich zu unerwarteten Zeiten, um sie zu der Kraft zu erheben, immer die nöthige Reinlichkeit walten zu lassen. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Leute sich schämen, einen Ort, für den Sorge getragen wird, zu verwahrlosen. Dieses ihr Gefühl, verbunden mit der Thatsache, daß sie nicht gern diejenigen, die sie zu lieben gelernt und deren Gesichtspunkt höher ist als ihr eigener, Dinge sehen lassen, welche sie betrüben würden, hat es uns möglich gemacht, beinahe jede Reform ist äußeren Dingen durchzuführen; der sicherste Weg, die Reinhaltung eines Ortes zu bewirken, war, ihn oft selbst zu besehen. Blickt man auf die Jahre zurück, wie sie vorübergehen, so sieht man einen Erfolg, der nicht klein ist; aber Tag für Tag hat man mit solchen Kleinigkeiten zu thun, daß sie die Geduld auf eine harte Probe stellen, wenn man nicht über sie hinaus und durch sie hindurch sieht – Schlösser zu repariren, Anzeigen zu machen, den fehlenden Schilling der Wochenmiethe drei- und viermal einzufordern, kleinliche Streitigkeiten zu schlichten, Verweise zu geben, die nämlichen Vorstellungen wieder und wieder zu machen. Aber von diesen Dingen und ihrer gewissenhaften Ausführung hängt das Leben der ganzen Sache ab, durch sie wird ein stetiges Fortschreiten gesichert. Es sind die kleinen Dinge dieser Welt, welche dem Leben unserer Mitmenschen die Färbung geben, und auf den ausdauernden Anstrengungen zu ihrer Verbesserung beruht der Fortschritt. Man sagt mir vielleicht: ‚Das ist recht gut, soweit es dich und deinen kleinen Kreis von Miethsleuten angeht, aber wie hilft uns das, mit den ungeheuren Massen von Armen in unseren großen Städten fertig zu werden?’ Ich antworte: ‚Bestehen die großen Massen von Armen nicht aus vielen kleinen Kreisen? Sind die großen Städte nicht in kleine Bezirke theilbar? Giebt es darin nicht Leute, die freudig bereit wären, die regelmäßige Leitung eines oder mehrerer Häuser zu unternehmen, wenn sie von dem Besitzer dazu autorisirt würden? Und warum sollte man nicht diese Leitung registriren können, sodaß mit der Zeit, wenn sich mehr und mehr Freiwillige fänden, die ganze Stadt eingetheilt würde und alle einzelnen Stücke der Arbeit wie Steinchen eines Mosaiks sich ist einander fügten, um ein verbundenes Ganzes zu bilden?’ Ich möchte diesen Mittheilungen aus Miß Hill’s kleiner Schrift noch hinzufügen: Wenn in einer Grube hundert Bergleute verschüttet sind und wir mit aller Kraft daran gehen, sie dem gewissen Tode zu entreißen, so kommt uns ja auch der natürliche Gedanke, daß nicht alle gerettet werden dürften. Allein das hindert unsere Anstrengungen nicht; wir preisen uns glücklich um Jeden, der zu neuem Leben erweckt wurde; wir halten uns für belohnt, wenn wir auch nur für einen gearbeitet haben. So sei es auch hier, und darum an’s Werk! Ist den größten Städten Deutschlands kann man Häuser mit 10 bis 12 Arbeiterwohnungen mit einer Anzahlung von 6000 bis 9000 Mark kaufen, und der übrige Theil des Geldes wird von Corporationen, Stiftungen und von Capitalisten dargeliehen werden, die so leicht – wenn es ein solches Unternehmen gilt – nicht kündigen würden. Und über ein Capital von 9000 Mark verfügt so manches ältere Mädchen, oder Menschenfreunde geben die Summe her, wenn das Haus unter eine richtige Leitung kommt. Auch können ja Eltern anstatt der Mitgift, welche sie ihrer Tochter im Falle der Verheirathung bestimmt haben, ein solches Grundstück für sie kaufen. Wie anders wird das Mädchen alsdann die Wohlthaten empfinden, welche ihr sicheres, edles Dasein ihr bietet; wie viel Gegenstände der Besprechung und Berathung wird es mit den theuern Eltern geben, nun jeder dieser drei in Liebe verbundenen Menschen einen Wirkungskreis nach seinen Kräften gefunden! Und wie viel Wärme wird das Mädchen aus dem schönen Familienkreise zu ihren Armen tragen, welche sie zu erziehen hat, ein Beruf, für den dem Weibe so wunderbare Begabung verliehen ist! Vor meiner Seele steht ein Ideal: Wenn jedes Haus, das Wohnungen für Arme bietet, unter der Verwaltung von edlen Frauen gleich Miß Hill stünde, wenn Siechenhäuser aller Orten die unheilbar kranken Bedürftigen aufnähmen, wenn Alters- und Krankencassen für alle die schwer ringenden, arbeitenden Männer gegründet wären, dann hätten wir den Socialismus und seine Irrlehren nicht zu fürchten. Wir wären alsdann im schönsten, wahrhaft göttlichen Sinne ‚ein einzig Volk von Brüdern‘.“ 5)
Ernst Rudorffs Tochter Gertrud Rietschel
Ernst Rudorff war seit 1876 mit Gertrud Charlotte Maria Rietschel (1853-1937) verheiratet. Das Paar bekam drei Kinder: einen Sohn und zwei Töchter. Rudorff hatte all seine Hoffnungen auf die Fortführung seines Werkes in seinen Sohn Hermann gelegt. Doch dieser starb im Februar 1916. Ernst Rudorff starb zehn Monate später. So übernahm die Tochter Elisabeth Rudorff (13.5.1879 Berlin – 27.5.1963 Hameln) die Fortführung des Werkes ihres Vaters und setzte sich „für den Schutz von Natur und Landschaft [ein].
Marlies Dittberner, Roswitha Kirsch-Stracke und Dagmar Krüger schreiben über Elisabeth Rudorffs Werdegang: „Elisabeth Rudorff lebt mit ihrer jüngeren Schwester Melusine in Lauenstein. Ihr ständiges Anliegen ist es, den Ith – einen Höhenzug im Wesergebirge – und seine Umgebung vor Eingriffen durch Flurbereinigung und forstwirtschaftliche Vorhaben zu schützen. Dazu führt sie zahlreiche Verhandlungen mit den Nutzungsberechtigten, pachtet und kauft Land zum Erhalt einzelner Naturdenkmale. Sie wendet sich mit Veröffentlichungen über die Situation des Iths an Zeitschriften, mobilisiert Einzelpersonen und Vereine zur Unterstützung ihrer Vorhaben.“ 6)
Elisabeth Rudorff wurde 1930 Mitglied der Bundesleitung des Volksbundes Naturschutz „und nimmt an überregionalen Naturschutztagen teil. Aus den Erfahrungen ihres lokalen Engagements heraus unterstützt sie die Forderung nach einem Naturschutzgesetz, das neben dem Erhalt von Arten und Lebensgemeinschaften auch den Schutz landschaftlicher Schönheit und Eigenart umfasst. Immer wieder richtet Elisabeth Rudorff seit den zwanziger Jahren Anträge zum Schutz des Iths an das Landwirtschaftsministerium und weitere Behörden. ‚Welche Schwierigkeiten, welche Kämpfe das alles in sich schließt, doppelt schwierig für mich als Frau...‘, so urteilt sie selbst. Dennoch bleibt sie bei ihrem Vorhaben, und als Konsequenz ihres Einsatzes werden 1939 wesentliche Teile des Iths bei Lauenstein als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Ihr Antrag auf Ausweisung als Naturschutzgebiet, den sie 1948 angesichts weiterer Eingriffe in die Natur des Iths gestellt hat, wird 1955 nach langjährigen, intensiven Verhandlungen abgelehnt. Erst 30 Jahre später erhält ein Teil des Lauensteiner Iths den Status als Naturschutzgebiet.“ 7)
Was wäre Ernst Rudorff ohne die Unterstützung durch Frauen?
Ernst Rudorff hatte Frauen viel zu verdanken: Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er von einer Frau: seiner Patentante Marie Lichtenstein (1817-1890), die eine Freundin der Komponistin und Pianistin Clara Schumann [Schumannstraße] war. Nachdem Marie Lichtenstein geheiratet hatte und deshalb von Berlin in den Harz verzogen war, wurde Ernst Rudorff von seiner Mutter Friedrike Dorothea Elisabeth, geb. Pistor (1808-1887) unterrichtet. Sein Vater war der Juraprofessor Adolf August Friedrich Rudorff (1803-1873). Später wurde Rudorff Schüler von Woldemar Bargiel, der ihn mit Robert und Clara Schumann bekannt machte. Clara gab dem jungen Mann in Berlin einige Stunden Klavierunterricht. Daraus entwickelte sich zwischen den beiden eine lebenslange Freundschaft. „1860 zeigte er Clara seine ersten Kompositionen. Sein Opus 1, Variationen für zwei Klaviere, widmete er ‚Frau Dr. Schumann in innigster Verehrung‘. Die Widmungsträgerin setzte sich bei Breitkopf & Härtel für die Drucklegung ein und spielte die Variationen 1866 in Wien gemeinsam mit Julie von Asten. Clara Schumann unterstützte Rudorff, wo sie konnte, gab ihm Rat in kompositorischen Fragen und machte ihn mit Werken anderer Komponisten, vor allem denjenigen von Brahms [Brahmsallee] bekannt.
(…) Er und Clara Schumann hatten auch gemeinsame Schüler. Clara schätzte Rudorffs pädagogische Fähigkeiten so hoch ein, daß sie ihm ihre Tochter Eugenie anvertraute.
Der Kontakt zwischen Clara Schumann und Ernst Rudorff war eng; Clara bat den Jüngeren bereits 1862, ihrer Tochter Elise bei der Suche nach Klavierschülern behilflich zu sein, Rudorffs Eltern nahmen vorübergehend den jüngsten Schumann-Sohn Felix auf, für Ferdinands Tochter Julie erbat Clara Konzertkarten. (…).
Die Anfrage Clara Schumanns, an der Gesamtausgabe der Werke Robert Schumanns mitzuwirken, lehnte er jedoch aus Gründen der Arbeitsüberlastung dankend ab. In späteren Jahren bedauerte Clara Schumann oft, dass sie den Freund so selten sah, doch wurde der Kontakt bis zum Tod Clara Schumanns brieflich aufrechterhalten. Rudorff seinerseits verehrte und bewunderte Clara Schumann tief.“ 8)